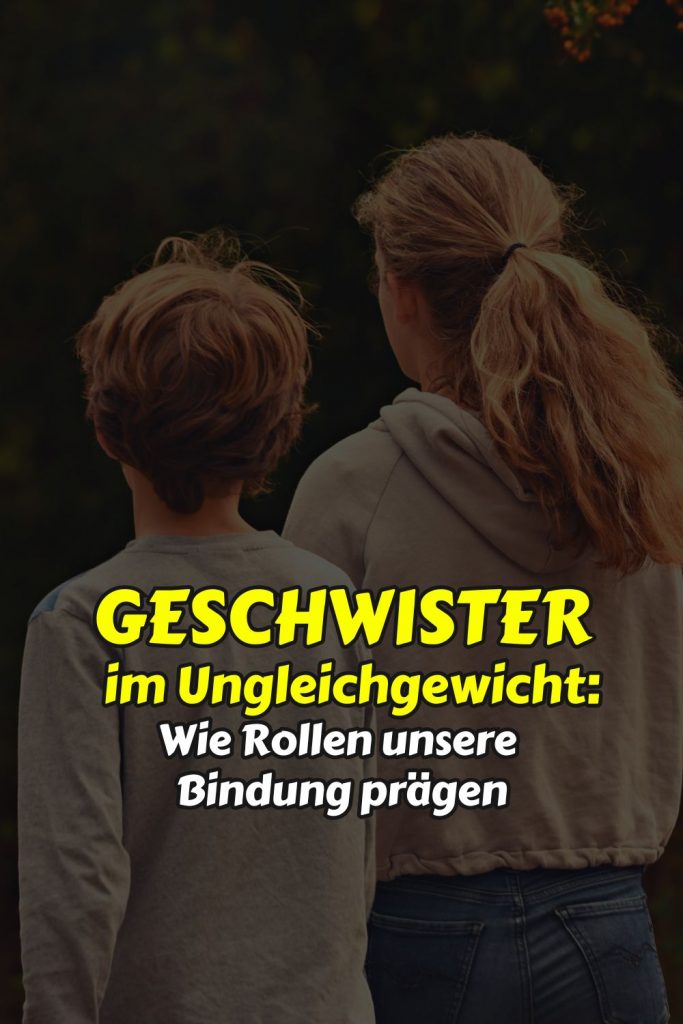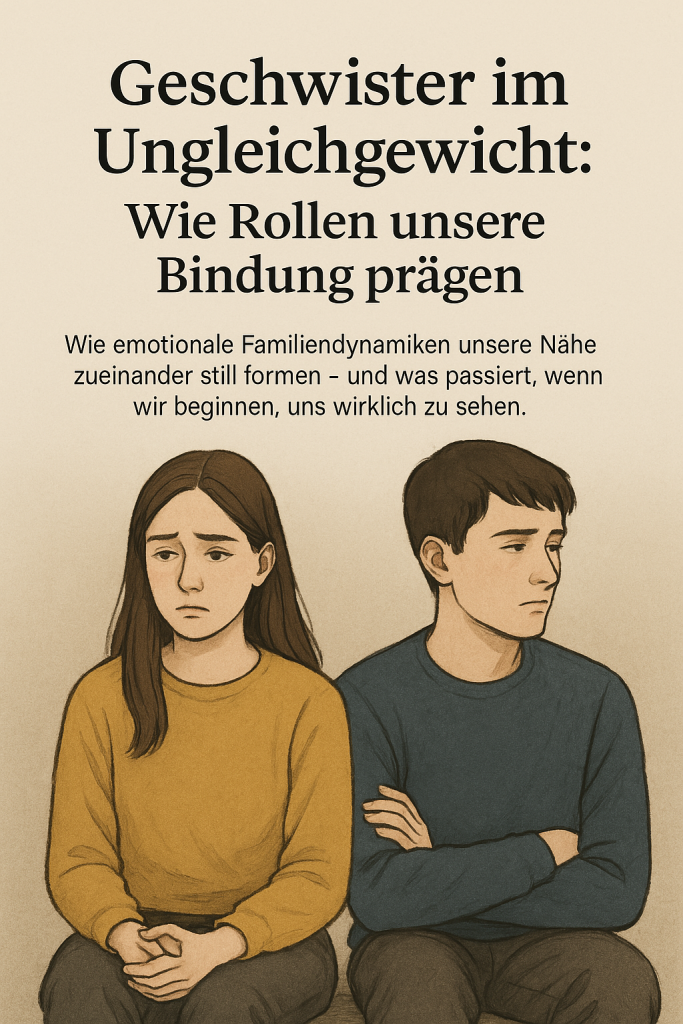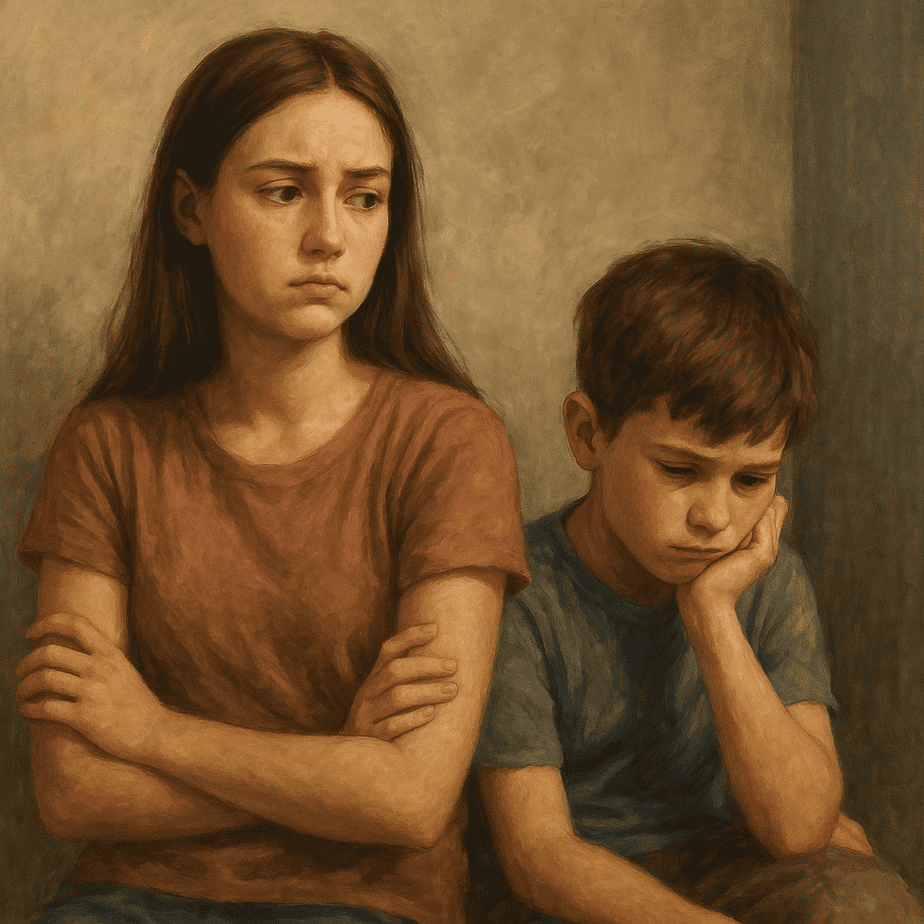Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass meine Geschwister und ich nicht in derselben Familie aufgewachsen sind – obwohl wir unter demselben Dach lebten.
Wir hatten dieselben Eltern, ja. Aber wir bekamen nicht dieselbe emotionale Erfahrung. Und wir trugen auch nicht dieselbe Verantwortung.
Ich war „die Große“. Die, die „vernünftig“ war. Die „sich zusammenreißt“. Und lange dachte ich, das sei etwas Gutes.
Bis ich begriff, dass ich keine große Schwester war – sondern ein kleines Mädchen, das wie eine Mutter funktioniert hat.
Wenn Kinder Eltern spielen – und dafür Liebe ernten
Heute weiß ich: Das nennt man Parentifizierung.
Damals nannte man es „vernünftig sein“.
Ich nannte es „auf Mama aufpassen“, wenn sie weinte. Oder „Stimmung retten“, wenn am Esstisch die Luft zu schneiden war.
Ich wusste, wann ich schweigen musste. Ich spürte, bevor jemand explodierte. Ich hatte Antennen für die kleinsten Veränderungen in Tonlage, Mimik, Gangart.
Während andere Kinder noch Kinder waren, war ich längst mit der emotionalen Architektur unserer Familie beschäftigt.
Ich war zwölf – aber innerlich längst erwachsen.
Manchmal auch neununddreißig. Oder fünfzig. Je nachdem, was das System gerade brauchte.
Ich war die, die nachts aufstand, wenn meine kleine Schwester weinte.
Ich war die, die Ausreden erfand, wenn mein Vater zu viel getrunken hatte.
Ich war die, die Hausaufgaben erklärte, den Überblick behielt, die „nicht noch zusätzlich nerven sollte“.
Und ich wusste: Wenn ich alles richtig mache, dann bleibt vielleicht alles ein kleines bisschen stabil.
Rollen, die nicht gewählt, sondern zugewiesen wurden
In unserer Familie wurde nie laut gesagt, wer welche Rolle hatte. Niemand sprach es aus, aber alles war spürbar. Als hätte man uns leise Markierungen auf die Stirn geschrieben, uns auf unsere Plätze gestellt, bevor wir überhaupt verstanden, dass ein Spiel begonnen hatte.
Ich war die Vernünftige – die, die immer wusste, was zu tun war, die mitdachte, mitfühlte, mittrug.
Mein Bruder war der Rebell. Derjenige, der laut wurde, der Türen knallte, der Grenzen austestete, vielleicht weil er spürte, dass jemand es tun musste.
Und meine Schwester – sie war das Sensibelchen. Die Zarte. Die mit dem großen Herzen, das alles aufsog wie ein Schwamm.
Jeder von uns hatte seinen Platz. Und wir funktionierten. Nicht etwa, weil wir es wollten, sondern weil es notwendig war.
Heute verstehe ich: Das war kein Charakter. Kein „so ist sie eben“. Kein „er war halt immer schon schwierig“. Es war ein System.
Ein unausgesprochenes, instinktives Arrangement – ein Tanz durch ein zerbrechliches Haus, in dem jeder Schritt stimmen musste, damit nichts umfiel. Und wir tanzten. Jahr um Jahr. Rolle um Rolle. Verantwortung um Verantwortung.
Bis wir vergaßen, dass wir nie selbst entschieden hatten, wer wir sein wollten. Wir waren Figuren im Schatten der Eltern – und hielten unsere Maske irgendwann für unser Gesicht.
Zwischen Nähe und Distanz – das Spannungsfeld der Geschwisterliebe
Lange war meine Beziehung zu meinen Geschwistern von Distanz geprägt. Nicht aus Wut, nicht aus Feindschaft – sondern aus einer feinen, vorsichtigen Unsicherheit. Wie zwei Menschen, die sich im selben Haus begegnet sind, aber nie im selben Raum wirklich gesehen haben.
Wir wussten viel voneinander, aber kaum etwas voneinander. Jeder trug seine Geschichte, seine Rolle, seine stillen Erklärungen für das, was gewesen war. Ich fühlte mich nicht wirklich erkannt in dem, was ich geleistet hatte, in dem, was ich geschluckt und getragen hatte.
Aber wenn ich ehrlich bin, habe auch ich sie nur durch meine eigene Linse betrachtet. Ich habe ihr Freisein gesehen, seine Lautstärke, ihre Tränen – und oft übersehen, was darunter lag.
Wenn wir sprachen, dann oberflächlich, freundlich, manchmal sogar warm – aber selten ehrlich. Unsere Worte berührten einander, aber nicht uns selbst. Jeder blieb in seiner vertrauten Position, mit einem halben Schritt zurückgezogen, als wäre Nähe gefährlich geworden.
Und doch war da immer dieses leise Ziehen unter der Haut, dieses unausgesprochene Etwas, das nie eine Stimme bekam, aber immer mitlief. Wie ein Nebensatz, der nie gesagt wurde, aber immer mitschwang. Du weißt gar nicht, was ich getragen habe. Du hattest es leichter. Warum warst du nie für mich da. Fragen, die niemand stellte, weil man spürte, dass die Antworten vielleicht mehr öffnen würden, als man bereit war zu halten.
Und so lebten wir weiter nebeneinander – verbunden durch etwas, das uns schützte und gleichzeitig trennte: das Schweigen.
Was hilft? Ehrlichkeit. Geduld. Und manchmal: Loslassen.
Es begann sich erst etwas zu verändern, als ich anfing, meine Rolle wirklich zu erkennen – nicht nur zu benennen, sondern zu fühlen, was sie mich gekostet hatte. Und als ich langsam lernte, sie zurückzugeben. Stück für Stück.
Nicht mehr reflexhaft zu vermitteln, zu schützen, zu erklären. Nicht mehr zu funktionieren, sondern zu spüren. Es war kein leichter Weg. Manchmal kam Unverständnis, weil das Neue fremd wirkte. Manchmal kam Widerstand, weil das Alte vertrauter war. Und manchmal kam gar nichts – nur Schweigen.
Aber dieses Schweigen war anders als früher. Es war kein Schweigen aus Verdrängung, sondern vielleicht ein erstes, tastendes Schweigen aus Überforderung. Es war ehrlich. Und irgendwo auf dieser Schwelle – zwischen Schmerz und Wahrheit, zwischen dem, was wir waren, und dem, was wir noch werden könnten – begann sich ein neuer Raum zu öffnen.
Ein Raum, in dem ich meine Schwester nicht mehr beschützen muss, sondern einfach fragen darf, wie es ihr wirklich geht, ohne Antwortvorgabe, ohne doppelten Boden. Ein Raum, in dem mein Bruder nicht mehr provozieren muss, um gesehen zu werden, sondern vielleicht zum ersten Mal nur gehört wird.
Ein Raum, in dem wir nicht mehr beweisen müssen, dass wir stark, klug, lustig oder wertvoll sind – sondern in dem wir einfach sein dürfen. Ohne Maske. Ohne Auftrag. Ohne Schuld. Vielleicht zum ersten Mal. Und vielleicht reicht das. Zumindest für einen Anfang.
Ein letzter Gedanke: Wir waren Kinder. Keine Held:innen. Keine Täter.
Am Ende bleibt vielleicht nur dieser eine Gedanke, der alles in mir still werden lässt: Wir waren Kinder. Keine Held:innen. Keine Täter. Keine Retter. Keine Versager. Nur Kinder – mitten in einem System, das uns geformt hat, lange bevor wir Worte dafür hatten.
Ich schreibe das nicht, um Schuld zu verteilen. Nicht um mit dem Finger zu zeigen oder Geschichten zurechtzurücken. Ich schreibe, um etwas sichtbar zu machen.
Etwas, das oft unter der Oberfläche bleibt – dort, wo es stumm weiterwirkt. Ich schreibe, um Raum zu schaffen für Bewusstsein. Für die feinen, kaum spürbaren Linien, die sich durch unsere Kindheit ziehen wie Haare in nassem Licht. Für die Rollen, die wir uns angezogen haben wie eine zweite Haut – und die wir manchmal noch heute tragen, obwohl das Familiensystem längst Vergangenheit ist.
Wenn du in einer Geschwisterbeziehung feststeckst, die sich eng oder kalt oder „unfair“ anfühlt – frag dich:
- Welche Rolle habe ich übernommen, um geliebt zu werden?
- Was habe ich gebraucht – und nie bekommen?
- Und was würde passieren, wenn ich heute einfach nur ich wäre – ohne Rolle?
Vielleicht entsteht daraus etwas Neues.
Still. Zart. Unaufgeregt.
Nicht spektakulär.
Aber echt.
Und das, glaube ich, reicht. Manchmal sogar mehr, als wir je gedacht hätten.