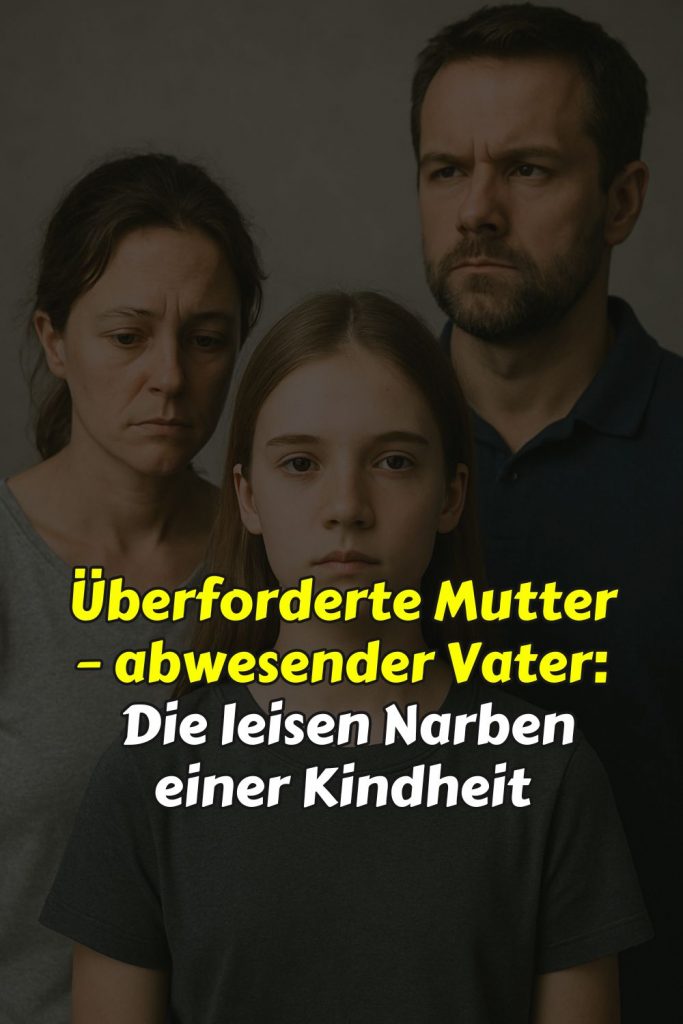Zwischen ihr, die zu viel fühlte – und ihm, der nie wirklich da war…
Ich erinnere mich noch an einen Sommernachmittag, ich war vielleicht neun Jahre alt. Meine Mutter hatte einen ihrer stillen Tage, an denen ihre Energie kaum reichte, um den Haushalt aufrechtzuerhalten, geschweige denn, mir zuzuhören oder mich in den Arm zu nehmen.
Sie lag auf dem Balkon in der Sonne, bewegungslos, mit geschlossenen Augen. Ich wollte ihr zeigen, dass ich ein Bild gemalt hatte – ein Haus mit einem Garten und einer fröhlichen Familie – aber ich blieb an der Tür stehen, weil ich spürte, dass heute nicht der richtige Moment war.
Und da war wieder dieses Gefühl: Ich muss warten, ich darf nicht stören, ich bin nicht dran.
Meine Mutter war erschöpft – und das schon lange, bevor ich alt genug war, es in Worte zu fassen. Als Kind spürte ich nur, dass sie oft gereizt war, dass ihre Bewegungen hart wirkten, ihr Blick abwesend war, ihre Stimme zu laut oder zu angespannt klang für das, was gerade gesagt wurde.
Ich wusste damals nicht, dass es Überforderung war. Ich dachte, ich sei anstrengend. Zu empfindlich. Zu fordernd. Zu viel.
Sie war ständig in Bewegung, ständig damit beschäftigt, irgendetwas zu regeln, zu organisieren, zu reparieren, zu überstehen. Es gab keinen Moment, in dem sie einfach nur da war – mit mir, bei mir.
Wenn ich sie um etwas bat, war ihre Reaktion oft übergroß. Nicht, weil sie mich ablehnte, sondern weil sie innerlich längst an der Grenze war. Ich glaube, sie fühlte sich allein mit allem. Allein mit den Kindern, allein mit dem Haushalt, allein mit ihrer Erschöpfung. Und weil niemand für sie sorgte, konnte sie auch für niemanden wirklich weich sein.
In der Rückschau begreife ich: Meine Mutter war nicht lieblos. Sie war überfordert. Ihre Form von Fürsorge bestand darin, dass alles sauber war, dass Essen auf dem Tisch stand, dass wir pünktlich zur Schule gingen. Aber emotionale Zuwendung – echtes Zuhören, ein ruhiger Moment, in dem sie mich einfach nur ansah, ohne zu bewerten oder weiterzuhetzen – die gab es kaum.
Sie hatte keinen Raum dafür. Und weil sie keinen Raum hatte, lernte ich, mich klein zu machen. Ich gewöhnte mir an, keine Hilfe zu brauchen. Ich entwickelte eine feine Antenne dafür, wie es ihr ging, um mich rechtzeitig zurückzunehmen. Ich wollte nicht der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Psychologisch gesehen spricht man hier von „Parentifizierung“ – dem Moment, in dem ein Kind beginnt, sich emotional um seine Eltern zu kümmern.
Ich war vielleicht neun oder zehn, als ich begriff, dass ich meine Bedürfnisse nicht direkt aussprechen durfte, sondern sie dosieren, anpassen, zurückhalten musste. Ich versuchte, sie aufzuheitern, wenn sie traurig war. Ich wollte sie stolz machen, damit sie mich ein wenig mehr liebt. Und ich war still, wenn ich merkte, dass sie an einem Tag einfach nichts mehr aufnehmen konnte.
Aus einem schutzlosen Kind wurde eine kleine Erwachsene, die Verantwortung übernahm, ohne es bewusst zu wählen.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter je darüber nachgedacht hat, was das mit mir gemacht hat. Vielleicht hat sie selbst nie gelernt, auf sich zu achten – geschweige denn auf die feinen Signale eines Kindes. Vielleicht war sie selbst ein Kind, das früh funktionieren musste.
Ich sehe sie heute mit anderen Augen. Nicht nur als Mutter, sondern als Mensch. Ich sehe ihre Anspannung, ihre Angst vor dem Versagen, ihren inneren Druck, alles irgendwie am Laufen zu halten. Und ich sehe, wie wenig Raum sie hatte, sich selbst zu spüren.
Und doch war ich das Kind. Ich hätte jemanden gebraucht, der mir sagt, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Jemanden, der mich hält, auch wenn ich weine. Der mich nicht nur dann lobt, wenn ich stark bin, sondern auch dann da ist, wenn ich schwach bin.
Aber sie konnte das nicht. Und das zu akzeptieren, ohne bitter zu werden, war vielleicht die größte Aufgabe meines Erwachsenenlebens.
Mein Vater war nie der Typ, der laut wurde oder auffiel. Er hatte keine Wutausbrüche, keine unkontrollierten Emotionen, keine eskalierenden Szenen. Vielleicht war es genau das, was es so schwer machte, ihn überhaupt einzuordnen.
Denn das Fehlen von offensichtlichem Fehlverhalten tarnt manchmal, wie tiefgreifend das, was fehlt, wirklich ist. Für mich als Kind war sein Schweigen nicht neutral – es war spürbar. Es war eine ständige Unsicherheit.
Ich wusste nie, ob ich willkommen bin, ob ich stören darf, ob ich einfach nur existieren darf, ohne Erwartungen erfüllen zu müssen.
Es gab kaum gemeinsame Erlebnisse. Keine Vater-Tochter-Ausflüge, keine Gespräche über mich, keine wirklichen Berührungen. Er war wie ein Mitbewohner, der nebenherlebte, ohne emotionalen Abdruck zu hinterlassen. Und doch war da ein Abdruck – weil er nichts hinterließ.
Seine Abwesenheit formte ein tiefes Loch in mir. Ich wünschte mir, dass er mir eine Geschichte vorliest, mir Fragen stellt, mir zuhört, wenn ich über meine Ängste rede. Ich wünschte mir, dass er mir ein Gefühl gibt, wichtig zu sein. Aber diese Wünsche blieben unausgesprochen. Weil ich spürte: Sie würden ins Leere laufen.
Einmal hörte ich andere Kinder erzählen, wie ihre Väter ihnen beim Fahrradfahren geholfen hatten. Ich sagte nichts. Ich erinnerte mich nicht daran, dass mein Vater mich je gelobt hätte, wenn ich etwas zum ersten Mal schaffte.
Ich erinnerte mich eher an seine stille Anwesenheit am Küchentisch, an den Fernseher, an die stummen Abende. Und ich erinnerte mich an mich – wie ich versuchte, mit kleinen Gesten Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ein Bild malen. Eine gute Note heimbringen. Mich anpassen. Nichts davon durchbrach sein Schweigen.
Ich habe lange geglaubt, dass es an mir lag. Dass ich einfach nicht interessant genug war. Dass ich nicht liebenswert bin. Das ist das Tragische an emotionaler Abwesenheit – sie ist schwer zu benennen, aber sie trifft tief. Weil sie dir keinen Widerstand bietet.
Du kannst nicht kämpfen. Du kannst nur aushalten. Und irgendwann ziehst du dich innerlich zurück, weil du verstanden hast, dass niemand kommt.
Diese Erfahrungen wirken weiter. Ich merkte es in meinem Umgang mit Männern. Ich fühlte mich zu denen hingezogen, die nicht richtig da waren. Ich interpretierte ihre Distanz als Herausforderung.
Ich dachte, wenn ich nur genug Liebe gebe, wird es irgendwann reichen. Ich wiederholte, was ich kannte – bis ich es als Muster erkannte. Und dann begann die Arbeit: zu fühlen, was ich damals nicht fühlen durfte. Zu betrauern, was nie war. Und zu akzeptieren, dass mein Vater nicht der war, den ich gebraucht hätte.
Ich will lernen, wie man wirklich zuhört. Wie man bleibt, auch wenn es anstrengend wird. Und wie man sich zeigt, ohne sich zu verlieren. ….
Vielleicht weiß er bis heute nicht, dass man auch mit Schweigen wehtun kann. Ich habe gelernt, das auszuhalten. Und ich habe gelernt, nicht mehr auf das zu warten, was nie kam.
Ich gebe heute mir selbst, was ich gebraucht hätte. Ich erkenne meine Trigger, ich beobachte meine Muster, und ich nehme mich selbst ernst – auch in Momenten, in denen ich mich klein fühle.
Und manchmal, wenn ich meiner Tochter zusehe, wie sie wild und frei durch den Garten läuft, laut lacht und mit ihren Fragen nicht aufhört, denke ich: Genau so hätte es auch für mich sein dürfen.
Das, was ich damals nicht hatte, kann ich heute für mich erschaffen. Ich bin nicht mehr das Kind, das mit einem Bild im Flur steht.
Und irgendwann beginnt man, sich selbst zu sehen
Ich habe lange geglaubt, dass etwas mit mir nicht stimmt – weil ich so viel fühlte, weil ich mir so sehr Nähe wünschte, weil ich immer wieder versuchte, gesehen zu werden. Aber heute weiß ich: Das, was ich damals vermisst habe, war berechtigt. Es war nicht übertrieben, nicht dramatisch, nicht zu viel. Es war menschlich. Kindlich. Natürlich.
Ich bin nicht mehr das Mädchen, das sich still zurückzieht, wenn es eng wird. Ich bin nicht mehr das Kind, das schweigt, um geliebt zu werden. Ich bin eine Frau geworden, die sich selbst zuhört. Die gelernt hat, dass sie Grenzen setzen darf. Dass sie Bedürfnisse hat, die nicht verhandelbar sind. Dass sie Liebe nicht beweisen muss – sondern verdient, so wie sie ist.
Und vielleicht ist das der leise Sieg über all das, was gefehlt hat: nicht, dass alles gut wird. Sondern dass ich mir selbst gut bin. Dass ich heute sehen kann, was damals verborgen blieb. Dass ich mich selbst halte – Stück für Stück, Tag für Tag.
Denn zwischen einer überforderten Mutter und einem abwesenden Vater ist ein Kind groß geworden, das sich selbst fast verloren hätte – und sich nun, Schritt für Schritt, zurückerobert.