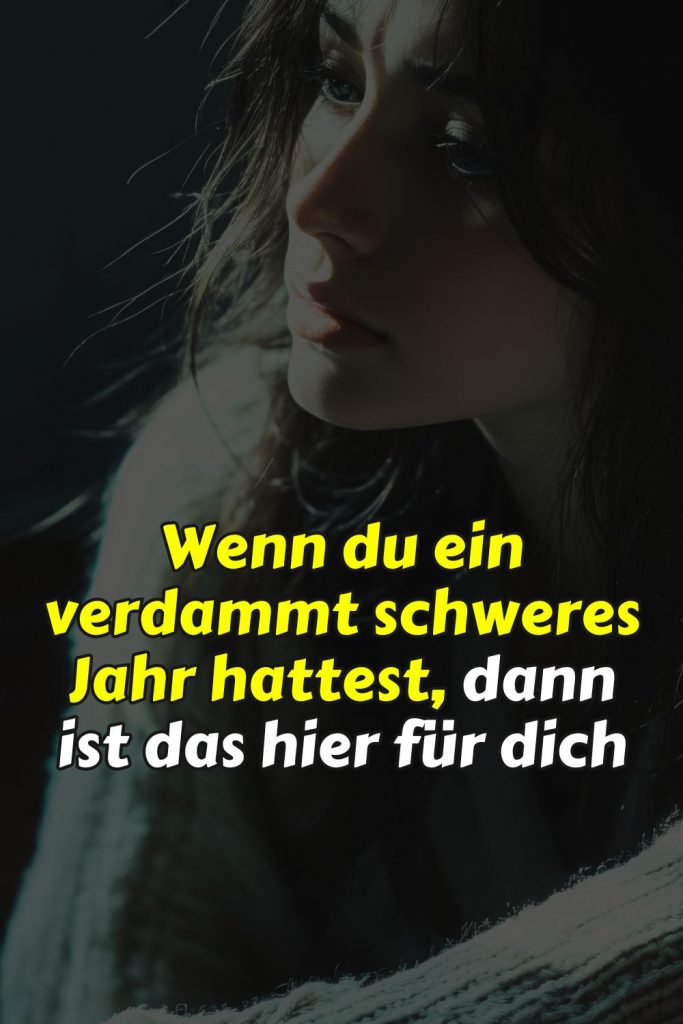Ja, ich meine dich. Dich da, die du gerade scrollst, während du eigentlich nur nach einem Grund suchst, das Bett zu verlassen. Dich, die du dir denkst: „Wenn noch einer sagt, es wird alles wieder, schreie ich.“
Dieser Text ist kein Pflaster. Er ist keine angeberische Surviver-Story. Er ist nur für dich und all das, was du nicht in Worte fassen konntest.
Weil man dir nicht erzählt hat, wie es wirklich ist, so ein Jahr. Man hat dir gesagt, dass Zeiten kommen und gehen. Dass Stürme dich nur stärker machen. Dass es nach dem Regen Sonnenschein gibt.
Aber niemand hat dir gesagt, dass du währenddessen manchmal vergisst, wer du überhaupt warst. Dass du manchmal morgens aufwachst und erst mal weinen musst, weil du wieder wach bist. Dass das Leben neben dir weiterläuft wie ein fremder Film, in dem du keine Rolle mehr spielst.
Die Schichten, die keiner sieht
Ein schweres Jahr ist nicht nur eine Kette von schlechten Tagen. Es ist wie ein Archäologe zu sein, der gräbt und gräbt und immer nur neue Schichten aus Dreck findet.
Du dachtest, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht, und dann kam noch etwas. Eine Nachricht. Ein Anruf. Ein Schweigen, das lauter war als alles andere. Du hast gelernt, dass Schicksal nicht fair ist, sondern nur grausam effizient manchmal.
Und die Menschen um dich herum, sie wollen helfen. Sie sagen: „Ich bin für dich da.“ Aber sie sehen nicht, dass du nicht mehr weißt, was das überhaupt bedeutet. Dass „dasein“ so viel Kompetenz erfordert, die du nicht mehr hast.
Du kannst nicht mal mehr sagen, was du brauchst, weil deine Bedürfnisse sich auf Null reduziert haben: Atmen. Durchhalten. Nicht auseinanderfallen. Mehr nicht.
Du fängst an, dich zu schämen. Für deine Stille. Für deine Antwortlosigkeit. Für die Tatsache, dass du bei „Wie geht’s?“ nicht mal mehr lügen kannst. Also versteckst du dich. Hinter „Alles gut, nur viel los.“
Hinter einem Lächeln, das du aus dem Internet geladen hast, weil deines kaputt ist. Du wirst zur Expertin des Funktionierens, während alles in dir schreit: „Ich funktioniere nicht!“
Der Körper als Geliebter Verräter
Dein Körper hat angefangen, zu flüstern. Dann zu schreien. Du dachtest, Trauer und Überlastung wären abstrakt, Gefühle, die im Kopf sitzen. Aber plötzlich hast du Migräne, die dich tagelang kampfunfähig macht.
Deine Gelenke tun weh, als hättest du einen Marathon gelaufen, während du nur im Bett gelegen hast. Dein Magen rebelliert gegen jede Mahlzeit. Du verlierst Haare, nicht einzelne, sondern ganze Strähnen. Und im Spiegel schaut dich jemand an, die du nur noch erahnst.
Die Ärzte sagen: „Stress.“ Du denkst: „Ja, Stress. Wie poetisch.“ Als wäre es eine Bagatelle. Als wäre dein Körper nicht das einzige, was dir noch geblieben ist, und jetzt fällt auch das noch auseinander.
Du schämst dich für deine Erschöpfung. Für das Gefühl, schon beim Aufstehen geschlagen zu haben.
Du siehst andere Frauen, die machen das alles: Job, Kinder, Workout, Selbstfürsorge mit grünen Smoothies. Und du schaffst es kaum, dich anzuziehen. Der Vergleich ist das Salz in einer Wunde, die ohnehin nie verheilen kann.
Die Isolation, die niemand meint
Die einsamste Sache an einem schweren Jahr ist nicht, allein zu sein. Es ist, einsam zu sein, während Menschen um dich sind. Du sitzt beim Essen mit Freunden und hörst ihnen zu, wie sie über Urlaubspläne und Beziehungskrämpfe reden.
Du solltest dich beteiligen, aber deine Gedanken kreisen nur um die eine Frage: „Wie halte ich das nur aus?“ Du wirst zur Expertin des Nicken und Lächelns, während in deinem Kopf die Schreie zu einem dauerhaften Rauschen werden.
Du verstehst, warum Menschen in Extremsituationen manchmal Kontakt abbrechen. Es ist nicht böse gemeint. Es ist Selbstschutz.
Weil die Normalität der anderen so laut ist, dass sie dein eigenes Leid übertönt. Weil du nicht noch einmal erklären kannst, warum du wieder nicht kommen kannst. Weil „Ich verstehe“ die leerste Phrase der Welt ist, wenn jemand offensichtlich nicht versteht.
Und dann ist da noch die Scham. Die Scham, eine Last zu sein. Du erinnerst dich, wie du früher selbst für Freunde da warst. Mit Lösungen, mit Trost, mit Energie. Jetzt bist du diejenige, die nur noch nimmt. Oder noch schlimmer: Die gar nichts mehr annimmt, weil sie nicht mehr weiß, wie.
Verlorengegangene Dinge
Ein schweres Jahr stiehlt nicht nur Zeit. Es stiehlt Dinge, die du nie auf einer Liste vermisst hättest. Dein Lachen zum Beispiel. Nicht das Lachen als Reaktion, sondern das Lachen aus dem Bauch, das dein Gesicht verzieht und deine Augen zum Leuchten bringt. Weg. Deine Unbekümmertheit.
Deine Fähigkeit, Pläne zu machen, ohne dass Angst dir die Hand lahmlegt. Dein Glaube an die Zukunft als Ort, an den man sich freuen kann.
Du hast gelernt, dass Verlust nicht nur Tod ist. Verlust ist auch: Das Vertrauen in deine eigene Belastbarkeit zu verlieren. Die Hoffnung, dass es einen Sinn gibt. Die Gewissheit, dass du morgen aufwachen und dich selbst wiedererkennen wirst.
Manchmal vermisst du sogar die Person, die du davor warst. So als hätte jemand anderes in deinem Körper gewohnt. Jemand mit leichteren Gedanken, mit mehr Platz im Kopf für Träume statt Sorgen.
Du würdest ihr gern sagen: „Tut mir leid, dass ich dich verloren habe.“ Aber du weißt nicht, wo sie ist oder ob sie je wiederkommt.
Die Wut, die still ist
Du bist wütend. Still, vergraben, aber da. Wütend darauf, dass das Leben so unverschämt weitermacht. Dass die Sonne scheint, während du im Dunkeln sitzt. Dass Menschen lachen, während du weinst. Dass es kein Betäubungsmittel gibt für das Gefühl, verraten zu sein vom eigenen Leben.
Du bist wütend auf dich selbst. Dass du nicht stärker bist. Dass du es nicht einfach schaffst, wie alle anderen. Dass dein Körper, dein Verstand, dein Herz nicht mitspielen.
Du verfluchst deine Sensibilität, die dich so tief fühlen lässt. Deine Intelligenz, die dir alle möglichen Szenarien ausrechnet. Deine Vorstellungskraft, die dir zeigt, wie es sein könnte, wenn nur…
Diese Wut frisst Energie. Aber du hast keine, also vergrabst du sie. Sie wird zum leisen Brodeln unter der Oberfläche. Manchmal platzt ein Zipfel davon heraus, wenn jemand etwas harmloses sagt wie: „Du solltest mal wieder rauskommen.“ Und du willst schreien: „ICH KANN NICHT MAL MEHR RAUS AUS MIR SELBST!“
Was du jetzt brauchst – und was nicht
Du brauchst keine Liste mit „10 Tipps für mehr Resilienz“. Du brauchst kein Meditation-App, das dir sagt, du sollst atmen, während du das Gefühl hast, zu ersticken. Du brauchst keine oberflächlichen „Du schaffst das!“-Sprüche von Menschen, die nicht mal wissen, was genau „das“ ist.
Was du brauchst, ist Erlaubnis. Erlaubnis, kaputt zu sein. Erlaubnis, nicht funktionieren zu müssen. Erlaubnis, wütend zu sein, traurig zu sein, leer zu sein. Du brauchst jemanden, der nicht fragt „Wie geht’s?“, sondern sagt: „Ich weiß, es geht nicht. Und das ist okay.“
Du brauchst Zeit. Und damit meine ich nicht die obligatorische „Gib dir Zeit“-Phrase. Ich meine echte, rohe, ungeschönte Zeit. Zeit, in der du nichts leisten musst.
In der du nicht besser werden musst, um anderen keine Umstände zu machen. Zeit, in der du einfach nur das biste, was du gerade bist: eine Überlebende.
Du brauchst Schonung. Nicht nur den Körper, sondern den ganzen Menschen. Du darfst Nein sagen. Du darfst absagen. Du darfst Menschen verlieren, die das nicht verstehen. Du darfst dich zurückziehen aus einer Welt, die zu schnell, zu laut, zu viel ist.
Die Dinge, die bleiben
Hier ist das Wunderbare, das niemand erwähnt: Ein schweres Jahr nimmt vieles, aber es gibt Dinge, die bleiben. Und manchmal entdeckst du sie erst, wenn du auf dem Boden liegst und denkst, jetzt gibt es nichts mehr.
Deine Wahrhaftigkeit bleibt. Du hast nicht mehr die Kraft zu lügen, also bist du echt. Das ist unbequem für viele, aber es ist dein größter Reichtum. Du siehst jetzt, wer wirklich zu dir hält und wer nur zur guten Figur da war.
Deine Stärke bleibt. Nicht die glamouröse Stärke aus Instagram-Quotes, sondern eine stille, verbissene Stärke. Die Stärke, jeden Morgen aufzustehen, obwohl du nicht willst.
Die Stärke, eine weitere Minute durchzuhalten, wenn dir eine Stunde zu viel ist. Die Stärke, die sich nicht als Heldengeschichte erzählen lässt, aber da ist, in deinen Knochen, in deinem Atem.
Deine Empathie bleibt. Vielleicht ist sie sogar gewachsen. Du weißt jetzt, wie sich Anfechtung anfühlt. Wie sich Verlorensein anfühlt. Du wirst niemals mehr jemandem sagen: „Schau mal auf die positive Seite.“ Weil du weißt, dass es keine gibt, wenn man erst mal unten ist.
Ein neues Verhältnis zu „besser werden“
Vielleicht wirst du nicht wieder die, die du warst. Und das ist das Schwerste. Weil du diese Person gemocht hast. Aber hier ist die Wahrheit, die niemand wagt zu sagen:
Du wirst jemand anderes. Jemand, der das Überleben gelernt hat. Jemand, der die Stille kennt. Jemand, der Schönheit in winzigen Dingen findet, weil große Freuden zu anstrengend sind.
Du wirst lernen, dass „besser werden“ nicht bedeutet, dass das Jahr ungeschehen gemacht wird. Es bedeutet, dass du einen Weg findest, es bei dir zu tragen.
Dass du es integrierst wie eine Narbe, die nicht mehr wehtut, aber immer sichtbar bleibt. Dass du manchmal weinst, wenn du daran denkst, und das okay ist.
Du wirst neue Rituelle entwickeln. Nicht die üblichen Self-Care-Routinen, sondern ehrliche. Vielleicht ist es okay, manchmal den ganzen Tag im Pyjama zu sein. Vielleicht ist es ein Sieg, nur die Zähne zu putzen. Vielleicht ist es genug, einmal tief durchzuatmen und zu sagen: „Heute habe ich überlebt. Morgen sehen wir weiter.“
Die Sprache des Schweigens
Es gibt ein Vokabular für das, was du durchmachst, aber es ist nicht aus Wörtern. Es ist das Nicken, wenn jemand ähnliches erlebt hat. Das kurze Aufflackern des Verstehens in den Augen. Das Schweigen, das nicht peinlich ist, sondern tröstend.
Du wirst Menschen finden, die diese Sprache sprechen. Die nichts sagen müssen, weil sie wissen, dass Worte die Wunden nur wieder aufreißen. Die einfach da sind, mit einer Decke, einer Tasse Tee, ihrer bloßen Anwesenheit.
Und vielleicht, irgendwann, wirst du selbst diese Sprache sprechen. Nicht als Beraterin, sondern als Mit-Reisende. Du wirst jemandem zuhören, der sagt: „Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll“, und du wirst nichts sagen außer: „Ich weiß. Und trotzdem tut man es.“
Ein unerwartetes Ende
Wenn du ein verdammt schweres Jahr hattest, dann gibt es kein Happy End. Es gibt keinen Moment, in dem sich alles auflöst wie in einem schlechten Film. Es gibt nur diesen einen Moment, an dem du aufwachst und merkst: Heute ist es nicht ganz so schlimm wie gestern. Und das ist alles.
Das ist nicht viel, aber es ist alles, was du brauchst. Ein kleines „weniger schlimm“, das sich zu „erträglich“ entwickelt, das sich zu „okay“ wandeln kann. Vielleicht, in ferner Zukunft, zu „gut“.
Aber lass dir nicht einreden, dass du dankbar sein musst für diese Erfahrung. Dass es einen Grund gegeben hat. Dass es dich gestärkt hat. Du darfst traurig sein. Du darfst wütend sein. Du darfst es verfluchen. Das ist dein Recht.
Du bist noch du
Und hier ist das Wichtigste, das ich dir sagen muss: Obwohl du dich nicht wiedererkennst, obwohl du glaubst, alles verloren zu haben – du bist noch du. Dein Wesen ist nicht in dem Jahr ertrunken. Es hat nur gelernt, unter Wasser zu atmen.
Du wirst wieder lachen. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Es wird ein Lachen sein, das tiefer kommt, weil es durch Schmerz gereinigt wurde. Du wirst wieder Pläne machen. Vorsichtiger, aber ehrlicher.
Du wirst wieder Freude empfinden. In kleinen, unerwarteten Momenten. In einer Tasse Kaffee, die genau richtig schmeckt. In einem Sonnenstrahl, der dein Gesicht erwärmt. In der Stille, die jetzt kein Feind mehr ist, sondern ein Freund.
Du hast ein Jahr überlebt, das andere nicht überlebt hätten. Du stehst noch. Vielleicht wackelig, vielleicht voller Narben, aber du stehst.
Und wenn du das nächste Mal jemanden fragst: „Wie geht’s?“ – dann denk an diesen Text. Denk daran, wie komplex diese Frage wirklich ist. Und sag lieber: „Ich bin da. Egal wie es dir geht, ich bin da.“
Weil das die einzige Wahrheit ist, die zählt. Nicht das „Es wird alles wieder gut.“ Sondern das „Ich bleibe, während es nicht gut ist.“
Du bist nicht allein. Und du bist nicht kaputt. Du bist nur mitten in einem Kapitel, das keiner lesen wollte. Aber du schreibst es trotzdem weiter. Jeden verdammten Tag.
Und das macht dich nicht nur stark. Das macht dich unglaublich menschlich.